Mein Christmas Mix 2010
Langjährige Fontblog-Leser kennen mein Interesse für vorweihnachtliche Pop-Musik (siehe: Das wird der Weihnachtshit 2007, Geschenktipp: Fünf neue Weihnachts-Alben oder Zwei freche Weihnachtssongs). Spätestens seit John und Yokos »Happy Xmas – War is Over« (1972) bin ich abhängig und sammle das Zeug wie ein Bekloppter. Mein iTunes zählt heute über 700 Titel aller Musikrichtungen mit dem Etikett »Christmas«. Und wie jeder Junkie brauche ich ständig neuen Stoff. Spätestens ab November eines jeden Jahres begebe ich mich auf die Suche nach neuen Weihnachtssongs. So entstanden in den vergangenen fünf Jahren unverbrauchte, zeitgemäße »Christmas-Mixtapes«, mit denen ich Freunde und Verwandte nerve … na ja, manche sind regelrecht begeistert und fragen spätestens am 1. Advent, wo den der Weihnachtsmix des Jahres bleibe.
Und so dachte ich mir, ich teile mal den Christmas Mix 2010 mit einigen mehr Freunden, zum Beispiel den Fontblog-Lesern. Meine Kriterien: Erscheinungsjahr ist 2010, möglichst keine Klischee (wenn ja, dann raffiniert inszeniert), Singer-Songwriter genießen Vorzug und nicht mehr als auf eine CD passt. Und das ist mein Ergebnis:
Warum Apple heute einen Rekordumsatz macht

Viele fragen sich: Was ist das Besondere daran, dass es jetzt Beatles-Songs auf iTunes gibt? Warum macht Apple Computer einen solchen Wind darum? Haben wir nicht alle schon die wichtigsten Songs von unseren CDs digitalisiert?
Vielleicht hilft die Biografie eines typischen Beatles-Fans beim Verständnis dieses besonderen Tages. Ich bin so alt wie Steve Jobs. Er ist, wie ich, mit den Beatles groß geworden. Als wir uns für die Band interessierten und die ersten eigenen Platten kaufen konnten, so um 1968, hatten die Fab-Four bereits innerlich gekündigt. Sie hielten ihre Scheidung noch 2 Jahre geheim, so dass wir uns gutgläubig die Alben »Abbey Road« und »Let it Be« in Vinyl zulegten. Wir dachten, es wären Beatles-Alben und es käme noch mehr … tatsächlich waren es Compilations von 4 Musikern, die einst als The Beatles angetreten waren und schon längst getrennte Wege gingen.
Die zuvor erschienen Alben hatten wir bei unseren älteren Brüdern oder bei reiferen Nachbarjungen gehört. Einige Alben hatte ich auf Musikkassette überspielt. Als die Beatles 1970 offiziell ihr Ende verkündeten, habe ich mir noch mal drei ältere Alben gekauft, um den Trennungsschmerz zu verdauen: Rubber Soul, Revolver und St. Peppers. Mit einem dieser Werke hat man sich damals mindestens vier Wochen lang beschäftigt, manchmal auch länger. Die posthum erschienenen Best-of-Doppelalben – das Blaue und das Rote – habe ich gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Sie verboten sich für einen echten Beatles-Fan, weil sie der Idee des vom Künstler komponierten Konzeptalbums widersprachen, mit der die Band über einen Zeitraum von 5 Jahren Maßstäbe gesetzt hatte.
Das Vinyl alterte. Heute steht es verstaubt in meinem verwaisten Jugendzimmer in der Heimatstadt. Dann kamen Ende der 80er Jahre die CDs, rausch- und knisterfrei, das war eine echte Versuchung. Drei Beatles-Alben habe ich mir auf CD gekauft, mehr wollte ich nicht investieren … außerdem gab es so viel gute neue Musik zu jener Zeit.
Dann im vergangenen Jahr die Remastered-Alben der Beatles. Warum sollte ich die kaufen, wo ich doch gerade meine CD-Sammlung auflöse. Nur zum Digitalisieren, um anschließend das Plastik zu entsorgen? Unsinn. Ich griff zu meinem Lieblings-Album (The Beatles, das weiße Album), um mal zu hören, was »remastered« bringt. Nicht viel mehr.
Jetzt endlich erscheinen der gesamte Katalog in zeitgemäßer Form. Damit rückt mir die Musik der Beatles sowohl technisch als auch vertrieblich so dich auf die Pelle, wie nie zuvor. Ich werde zugreifen, und den einen Kaufen-Knopf drücken. Und mit mir werden das viele Tausende andere auf der ganzen Welt tun. Und noch vor dem Wochenende – jede Wette – erscheint eine Pressemitteilung von Apple, die verkünden wird, das noch nie so viele Beatles-Musik in solch kurzer Zeit verkauft wurde.
Unterhaltung aus der Provinz

Ich werde mir heute Abend zum ersten Mal »Das perfekte Promi-Dinner« ansehen (Vox, 20:15 Uhr), weil es bei einem alten Freund in meiner Heimatstadt Bad Camberg spielt, dem Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl (»Ich will Spaß«). Unter dem Motto »Frankfurter Runde« tritt Markus auch am heimischen Herd gegen Hochsprung-Olympiasiegerin Heike Henkel, DSDS-Finalist Manuel Hoffmann und Schauspielerin Alice Hofmann an, die »Hilde« aus der »Familie Heinz Becker«. Mit welchem dreigängigen Menü Markus den Sieg einfahren möchte, durfte er vor der Ausstrahlung der Show nicht verraten.
Was ich aber verraten darf ist, dass er (laut unseres Lokalreporters) zum 12-köpfigen Dschungelcamp-Team gehört, das im Januar 2011 in Australien bei der 5 Staffel der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus antreten wird.
Brief an mein Lieblingsradio

Vorbemerkung
Wer sich in Berlin für Politik und Kultur interessiert, früh aufsteht, abends noch mal das Radio einschaltet und gerne anständige Musik hört – für den gibt es nur einen Sender: Radio Eins. Ich behaupte sogar: Wahrscheinlich das beste gemischte Radio der Republik. Dies schreibe ich als jemand, der mit dem legendären SWF 3 (später SWR 3) aufgewachsen ist, und es immer wieder mal mit dem Hessischen, Bayerischen oder Westdeutschen Rundfunk versucht hat … die sind alle gut, selten sehr gut.
![]() Radio Eins entstand 1997 aus B Zwei und Radio Brandenburg, ist öffentlich-rechtlich und gehört zum Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB), der in der deutschen Medienlandschaft bisher kaum Wegweisendes zustande gebracht. Fast schon peinlich: Die regionale Nachrichtensendung RBB Abendschau (19:30 – 20:00), der es dauerhaft gelingt, die spannenden Themen einer Weltmetropole und deren Umland herunterzubrechen auf Tiergeburten im Zoo, Wohnungsbrände, Schienenersatzverkehr, Adressen zum Obst-Selberpflücken und die jährlich wiederkehrenden Dramen um den Weihnachtsbaum an der Gedächtniskirche. Gäbe es Radio Eins mit Bildern … das wäre die Abendschau wie ich sie mir für die Hauptstadt wünsche.
Radio Eins entstand 1997 aus B Zwei und Radio Brandenburg, ist öffentlich-rechtlich und gehört zum Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB), der in der deutschen Medienlandschaft bisher kaum Wegweisendes zustande gebracht. Fast schon peinlich: Die regionale Nachrichtensendung RBB Abendschau (19:30 – 20:00), der es dauerhaft gelingt, die spannenden Themen einer Weltmetropole und deren Umland herunterzubrechen auf Tiergeburten im Zoo, Wohnungsbrände, Schienenersatzverkehr, Adressen zum Obst-Selberpflücken und die jährlich wiederkehrenden Dramen um den Weihnachtsbaum an der Gedächtniskirche. Gäbe es Radio Eins mit Bildern … das wäre die Abendschau wie ich sie mir für die Hauptstadt wünsche.
Seit vielen Jahren setzt Radio Eins für die Eigenwerbung seines gleichermaßen anspruchsvollen wie unterhaltsamen Programms den Slogan »Nur für Erwachsene« ein. Der Sender tut dies gebetsmühlenartig im eigenen Programm, oft auch unbedacht, zum Beispiel wenn eine Programmempfehlung für eine Kindertveranstaltung ausklingt mit dem überstrapazierten akustischen Dreiklang-Claim: Für A, für B und natürlich … nur für Erwachsene.
Brief
Liebes Radio Eins vom RBB,
es war sicher richtig, dass du dich nach deiner Gründung 1997 mit dem Motto »Nur für Erwachsene«, ausgeliehen beim Rotlicht-Milieu, provokant in Szene gesetzt hast. Du wolltest kein Dudelfunk sein, wie es schon so viele in Berlin gibt, sondern ein anspruchsvoller Sender, der seine Hörer ernst nimmt, sein Musikprogramm nicht dem Computer überlässt und seine Moderatoren zu politischen Live-Interviews und -Stellungnahmen motiviert. Die Botschaft ist angekommen. Der Erfolg gibt dir Recht.
Jeder Claim nutzt sich ab, gerade wenn er täglich vielfach ausgestrahlt wird. 13 Jahren sind nicht nur zu lange für »Nur für Erwachsene«, inzwischen schadet der Satz, weil er nicht mehr trifft. Viele Erwachsene, die Radio-Eins-Fans geworden sind, haben inzwischen Kinder und sind durchaus der Ansicht, dass auch sie Radio Eins hören sollten. Auch mancher Jugendlicher dürfte sich von Radio Eins eher angesprochen fühlen als von den ungezählten privaten »Das beste von heute …«-Alternativen.
Dein Slogan, an dessen Schöpfung wahrscheinlich kein professioneller Werber beteiligt war, hat den Geburtsfehler, dass er interessierte Menschen mit dem Wörtchen »nur« ausschließt. Reich ihnen die Hand, sagt doch in Zukunft einfach:
Radio Eins – Für Erwachsene. Oder lasst den Claim einfach weg, denn Qualität spricht für sich. Dieser Tipp ist schnell umgesetzt, bürgt für Kontinuität und ist selbstverständlich kostenlos.
Dein treuer Hörer
Fontblog (Jürgen Siebert)
Worüber ich morgen sprechen werde
 E-Mails und Gespräche in den letzten Tagen zeigen mir, dass ich etwas über meine Präsentation morgen schreiben sollte. Vor 4 Wochen habe ich gegenüber der Kunstbibliothek (Kulturforum) zugesagt, einen Vortrag als Vertretung für Erik Spiekermann zu halten, der im Moment in New York weilt. Er findet statt im Rahmen eine Veranstaltungsreihe zur Ausstellung »Welt aus Schrift«, über die ich hier im Fontblog bereits mehrfach berichtet habe. Das gesamte Programm auf dieser Seite, rechts auf Führungen/Veranstaltungen klicken.
E-Mails und Gespräche in den letzten Tagen zeigen mir, dass ich etwas über meine Präsentation morgen schreiben sollte. Vor 4 Wochen habe ich gegenüber der Kunstbibliothek (Kulturforum) zugesagt, einen Vortrag als Vertretung für Erik Spiekermann zu halten, der im Moment in New York weilt. Er findet statt im Rahmen eine Veranstaltungsreihe zur Ausstellung »Welt aus Schrift«, über die ich hier im Fontblog bereits mehrfach berichtet habe. Das gesamte Programm auf dieser Seite, rechts auf Führungen/Veranstaltungen klicken.
Mein Vortrag lautet »Die 7 Stufen der Technologiekritik«. Ich hatte beiläufig in einem Kommentar am 23. September schon mal auf die Beschäftigung mit diesem Thema hingewiesen. Inzwischen weiß ich mehr und kann ein paar Zeilen dazu verlieren. Eines vorweg: Ich zeige keine Buchstaben, keine Schriften, keine typografische Pretiosen – dafür gibt es die Ausstellung. Und doch ist mein Thema ganz eng mit dem Gebiet der schriftlichen Kommunikation verknüpft.
Ich habe in meiner 25-jährigen Berufslaufbahn zwei Revolutionen und einige Evolutionen in der grafischen Industrie erlebt. Sie waren stets begleitet von neuen Techniken. Die Reaktion der Menschen auf die neuen Techniken lässt sich, grob vereinfacht, in zwei Lager zusammenfassen: die Begeisterten und die Kritischen – natürlich mit beliebig vielen Abstufungen dazwischen. Meine bewusst einfaches Weltbild dazu, dass ich morgen präsentieren werde: Die Skeptiker isolieren sich und schaufeln sich (beruflich gesehen) ihr eigenes Grab, die Begeisterten haben Erfolg im Job und ein erfülltes Berufsleben.
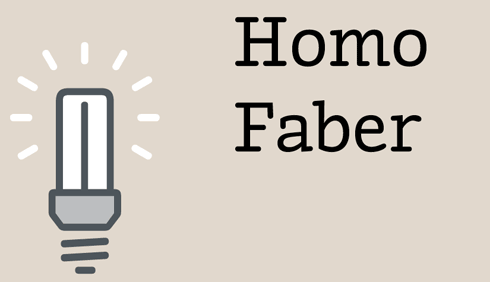
Die Diskussion gestern und vorgestern hier im Blog – mit und zwischen Florian Pfeffer und Erik Spiekermann – hat noch mal gezeigt, dass eine aufgeklärte Gesellschaft nicht den Ingenieuren und Skeptikern das Feld überlassen darf. Mein Vortrag wird zeigen, wie man die »Yes-butter« von den »Why-nottern« unterscheidet. Er wird zeigen, wie uns (kreative) Technik helfen kann und warum sie uns unnötigerweise oft terrorisiert. Es wird um Apple und Microsoft gehen, um Facebook, Twitter und das Bloggen, um iPhone, Blackberry, iPad und mehr. Bis morgen, 18:00 Uhr im Kulturforum.
Fontblog nervt!
Die Leser haben das Wort:
Kurz und (links)bündig: immer auf Twitter
Wer Fontblog auf Twitter verfolgt weiß seit 10 Minuten, dass die Financial Times Deutschland am Montag in neuem Gewand erscheint. Außerdem habe ich heute noch mitgeteilt, dass das Jahrbuch der Werbung jetzt komplett und kostenlos online zu lesen ist, der Red-dot-Award nichts mehr wert ist, dass ich heute Abend auf dem Berliner Typo-Stammtisch anzutreffen bin, Scholz & Friends mit 1000 Mitarbeitern auf Google Apps umsteigt und dass es zur Ausstellung Welt aus Schrift eine Facebook-Fan-Seite mit vielen Abbildungen und Vortragstipps gibt. Ich musste es mal wieder sagen: Schnell und schmutzig = Twitter, lang und tiefsinnig = Blog.
Das Buch ist tot, es lebe das Lesikon
 Am 11. November 2004 hatte ich mein Wikipedia-Schlüsselerlebnis. Warum weiß ich das so genau? Es war der Todestag von Jassir Arafat, dem damaligen Präsidenten der palästinensischen Autonomiegebiete. Am gleichen Tag feierte das »ZEIT-Lexikon in 20 Bänden« Premiere. Den ersten Band (A-Bar) gab es kostenlos zusammen mit der Wochenzeitung, die Folgebände erschienen dann wöchentlich zum Preis von 9,00 €, glaube ich. Ich spielte mit dem Gedanken, mir zum ersten und letzten Mal ein mehrbändiges Lexikon anzuschaffen.
Am 11. November 2004 hatte ich mein Wikipedia-Schlüsselerlebnis. Warum weiß ich das so genau? Es war der Todestag von Jassir Arafat, dem damaligen Präsidenten der palästinensischen Autonomiegebiete. Am gleichen Tag feierte das »ZEIT-Lexikon in 20 Bänden« Premiere. Den ersten Band (A-Bar) gab es kostenlos zusammen mit der Wochenzeitung, die Folgebände erschienen dann wöchentlich zum Preis von 9,00 €, glaube ich. Ich spielte mit dem Gedanken, mir zum ersten und letzten Mal ein mehrbändiges Lexikon anzuschaffen.
 Doch Band 1 der ZEIT-Edition war am selben Tag veraltet, an dem er erschien: Arafat verstarb um 3:30 Uhr in der Früh in Paris, sein Leichnam sollte noch am selben Tag nach Kairo geflogen werden, wo 24 Stunden später die Trauerfeier stattfinden sollte. Im ZEIT-Lexikon lebte der Friedensnobelpreisträger weiter. Ich rief Wikipedia auf, suchte nach Arafat und stellte fest, dass nicht nur sein Todestag bereits eingetragen war, sondern die gesamte Krankengeschichte der zurückliegenden 14 Tage.
Doch Band 1 der ZEIT-Edition war am selben Tag veraltet, an dem er erschien: Arafat verstarb um 3:30 Uhr in der Früh in Paris, sein Leichnam sollte noch am selben Tag nach Kairo geflogen werden, wo 24 Stunden später die Trauerfeier stattfinden sollte. Im ZEIT-Lexikon lebte der Friedensnobelpreisträger weiter. Ich rief Wikipedia auf, suchte nach Arafat und stellte fest, dass nicht nur sein Todestag bereits eingetragen war, sondern die gesamte Krankengeschichte der zurückliegenden 14 Tage.
Beim Stöbern in Wikipedia fiel mir auf, dass es zu einem Thema, das mich gerade sehr beschäftigte, noch keinen Eintrag gab: Eurozeichen. Ich wurde freundlich von einem automatischen Redaktionssystem aufgefordert, einen Beitrag zu schreiben, weil es zu diesem Begriff noch keinen gäbe. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich hatte einen Vortrag über das neue Schriftzeichen für die ATypI-Konferenz in der Schublade – Text plus Abbildungen –, den ich nur kürzen musste.
 Wenige Stunden später waren bereits einige Wikipedia-Aktivisten am Werk, prüften meinen Artikel auf Herz und Nieren, diskutierten und formatierten ihn schließlich nach den Wiki-Richtlinien. Noch heute ist er hier zu finden, inzwischen vielfach aktualisiert, bedeutend kürzer, weniger typografisch, eher technisch ausgerichtet; eine Abbildung von mir hat immerhin überlebt. Eine zweiten Wikipedia-Beitrag habe ich nie mehr geschrieben. Zwei Dinge hatte ich an diesem Tag gelernt: Das gedruckte Lexikon ist tot und Wikipedia wird es besser ersetzen, als man sich das im Moment vorstellen konnte.
Wenige Stunden später waren bereits einige Wikipedia-Aktivisten am Werk, prüften meinen Artikel auf Herz und Nieren, diskutierten und formatierten ihn schließlich nach den Wiki-Richtlinien. Noch heute ist er hier zu finden, inzwischen vielfach aktualisiert, bedeutend kürzer, weniger typografisch, eher technisch ausgerichtet; eine Abbildung von mir hat immerhin überlebt. Eine zweiten Wikipedia-Beitrag habe ich nie mehr geschrieben. Zwei Dinge hatte ich an diesem Tag gelernt: Das gedruckte Lexikon ist tot und Wikipedia wird es besser ersetzen, als man sich das im Moment vorstellen konnte.
 Ich bekunde hier offen, dass ich das Aussterben von Wörterbüchern, Lexika, Telefonbüchern, eitlen Jahrbüchern, Coffee-Table-Books, Atlanten und all diese schnell veraltenden Nachschlage- und Schaumschlägerwerke zutiefst begrüße. Ja, die Entwicklung geht mir gar nicht schnell genug: Spätestens wenn im Herbst wieder die Paletten mit den Gelben Seiten in den Supermärkten stehen ärgere ich mich wieder über diesen Unfug. Was wir stattdessen brauchen sind: liebevoll geschriebene und ebenso liebevoll hergestellte Unterhaltungsbücher, sowie Sachbücher, die uns durch die unendliche (digitale) Welt der Informationen lotsen. Und damit sind wir beim Lesikon.
Ich bekunde hier offen, dass ich das Aussterben von Wörterbüchern, Lexika, Telefonbüchern, eitlen Jahrbüchern, Coffee-Table-Books, Atlanten und all diese schnell veraltenden Nachschlage- und Schaumschlägerwerke zutiefst begrüße. Ja, die Entwicklung geht mir gar nicht schnell genug: Spätestens wenn im Herbst wieder die Paletten mit den Gelben Seiten in den Supermärkten stehen ärgere ich mich wieder über diesen Unfug. Was wir stattdessen brauchen sind: liebevoll geschriebene und ebenso liebevoll hergestellte Unterhaltungsbücher, sowie Sachbücher, die uns durch die unendliche (digitale) Welt der Informationen lotsen. Und damit sind wir beim Lesikon.
Was soll das sein. Das Lesikon ist eine Erfindung von Juli Gudehus. Vor fast 9 Jahren, im Februar 2002, wurde ich erstmals mit dieser Idee konfrontiert. Juli schrieb mir einen Brief, in dem sie mir versprach, dass ich mich unsterblich machen könne, wenn ich zu den Begriffen Informationsdesigner, nichtssagend, Handmarke, Erfahrung und visuelle Früherziehung einen persönlich Text, aber im lexikalischen Stil verfassen würde. Ich antwortete noch am selben Tag und lieferte die fünf Texte ab, ohne zu wissen, was damit passieren soll. Dann hörte ich jahrelang nichts mehr dazu.
Vor einigen Monaten dann weihte mich Juli Gudehus in das Projekt ein, dass jetzt unter dem Namen Das Lesikon der visuellen Kommunikation beim Verlag Hermann Schmidt in Mainz erscheint. Ich habe es selbst noch nicht in Händen gehalten und kann auch nur das zitieren, was der Verlag seit gestern dazu veröffentlicht hat: »9704 Begriffe der visuellen Kommunikation hat Juli Gudehus zusammen getragen, mit Unterstützung von 3513 ›Co-Autoren‹ definiert, kommentiert, mit Meinungen und Erfahrungen garniert und geordnet. Nicht von A bis Z, sondern von Avantgarde bis After Image, nicht streng logisch, sondern kreativ-assoziativ webt sie daraus eine unendliche Geschichte. Widersprüche werden zum Denkanstoß. Ein literarisches Labyrinth, in dem Sie surfen und sich treiben lassen, sich verlieren und Vertrautes wieder finden. Eine Odyssee, die genau so viele Fragen aufwirft, wie sie beantwortet.« (Aha, ich bin also einer von 3513 Co-Autoren … mächtig, mächtig.)
 Wenn das 3000-seitige Lesikon so geworden ist, wie ich es mir in den zurückliegenden Wochen ausgemalt habe – nach vielen Telefonaten mit der Autorin und der Verlegerin – dann wird es eine Sensation. Dann wird man das Buch in 20 oder 30 Jahren als Übergangslektüre einordnen, eine Brückenbuchspezies zwischen dem aussterbenden Lexikon und dem nahenden E-Book. Dann ist das Lesikon exakt der Wissenslotse, den wir jetzt brauchen, in einer Zeit, in der praktische alle Informationen frei zugänglich sind, aber selbst intellektuelle Größen wie Frank Schirrmacher vor dieser Flut kapitulieren.
Wenn das 3000-seitige Lesikon so geworden ist, wie ich es mir in den zurückliegenden Wochen ausgemalt habe – nach vielen Telefonaten mit der Autorin und der Verlegerin – dann wird es eine Sensation. Dann wird man das Buch in 20 oder 30 Jahren als Übergangslektüre einordnen, eine Brückenbuchspezies zwischen dem aussterbenden Lexikon und dem nahenden E-Book. Dann ist das Lesikon exakt der Wissenslotse, den wir jetzt brauchen, in einer Zeit, in der praktische alle Informationen frei zugänglich sind, aber selbst intellektuelle Größen wie Frank Schirrmacher vor dieser Flut kapitulieren.
Ich gehe jede Wette ein, dass es bald Lesika für die Politik, die Wirtschaft, die Popmusik, Mode, Sport und Autos geben wird – die uns an die Hand nehmen, damit wir unseren ganz eigenen, persönlichen Pfad durch den Dschungel des Fachwissens finden können … ohne nervös zu werden, ohne zu kapitulieren, ohne aufgeben zu müssen. Ich freue mich auf die erste Begegnung mit dem neusten Werk von Juli Gudehus. Danke schon mal im voraus dafür Juli, dass du uns Designern mit dieser Premiere sowohl einen taktischen Vorsprung als auch ein Vorbildmedium geschaffen hast.
Selbstverständlich wird es das Lesikon nach der Buchmesse auch auf www.fontblog.de geben. Und wie damals beim wunderbaren »Fraktur Mon Amour«, das die Autorin Judith Schalansky signierte, werden auch die ersten 100 Exemplare des Lesikon unser Haus mit Signatur und persönlicher Widmung verlassen (vgl.: … das ist Typo-Sex, was Du hier machst, Fontblog im März 2006).
Abbildungen: Wikimedia Foundation, Inc., World Economic Forum, swiss-image.ch (Foto: Remy Steinegger), Verlag Hermann Schmidt, FontShop (Foto: Marc Eckardt)

